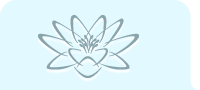Gut zu wissen
Macht Armut krank ?!
Bis zu 12 Jahre länger leben deutsche Männer aus dem obersten Einkommensviertel im Vergleich zu jenen im untersten Einkommensviertel (bei Frauen sind die Unterschiede etwas weniger drastisch). Ebenfalls eklatant sind die bekannten Morbiditäts-Unterschiede zwischen reichen und armen Menschen. Die klassische Frage, ob es sich hierbei um Selektionseffekte („Kranke werden eher arm“) oder um Kausationseffekte („Arme werden eher krank“) handelt, ist heute weitgehend beantwortet: Bei Erwachsenen liegt vorwiegend soziale Selektion vor (Müller, Heinzel-Gutenbrunner, 1998). Chronisch schlechte Gesundheit ist also primär mit einem erhöhten Armuts-Risiko verbunden. Bei Kindern führt das Aufwachsen in Armut eher zu chronischen Krankheiten im Erwachsenenalter.
Vielen Ärztinnen und Ärzten in Praxis oder Klinik ist dies auch ohne teure Sozialforschung klar sie wissen: „Krankheit macht arm, Armut macht krank“. Und die meisten von ihnen betreuen jeden Patienten, meist ohne Murren, meist ohne Ansehen der Person oder des sozialen Status. Dramatisch wird es, wenn die Ressourcen, die eigentlich allen Patienten zur Verfügung stehen sollten, durch eine aktuelle „Sozial“-gesetzgebung nicht mehr bei allen ankommen, z.B., wenn Praxisgebühr oder Zuzahlung arme Patienten überfordern.
„Pflicht zur Gesundheit“ Wollen wir das?
Ob jedoch aus dem Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 unseres Grundgesetzes „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ oder einem hieraus abgeleiteten, zukünftigen „Recht auf Gesundheit“ eine Lösung des bundesdeutschen Armuts- und Gesundheitsproblems erwächst, mag mit Fug und Recht bezweifelt werden. Nicht nur, weil ein solches Grundrecht auf Gesundheit würde es denn eingeklagt werden endgültig das Aus für unser Sozialwesen bedeuten würde. Sondern auch, weil von der vielleicht gut gemeinten Intention, unter Mitsprache der jetzigen Gesundheitsministerin, nur eine sozialdarwinistische „Pflicht zur Gesundheit“ übrigbleiben dürfte.
„Empowerment“ für Arme: Nach der Ich-AG die Elends-AG?
Die Idee, die Gesundheitsförderung sozial benachteiligter Mitmenschen an neue Dienstleister-Netzwerke jenseits des klassischen „Gesundheitswesens“ zu übergeben, wie es z.B. die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung seit Jahren propagiert, erfährt aktuell eine bemerkenswerte Renaissance, wie bei dem 13. Kongress „Armut und Gesundheit“ der Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit, Berlin, deutlich wurde. Und zwar durch einen Referenten-Entwurf zu einem „Präventionsgesetz“ (= Neuauflage eines 2005 gescheiterten Gesetzentwurfs). Mit diesem Gesetz sollen sich auch praktikable Lösungen für das Krankheitsproblem der Armen finden lassen. Das für alle Betroffenen völlig unverständliche Lösungswort heißt dabei „Empowerment“ oder Teilhabe an der Gesellschaft durch Selbstgestaltung seines Schicksals (zynisch könnte man es auch als „Elends-AG“ bezeichnen). Ob von den im Gesetzentwurf avisierten 250 Millionen Euro pro Jahr, wenn sie denn erst im Rachen der bereits jetzt „Hurra!“ rufenden Sozial-Institutionen versickert sind, bei den sozial Benachteiligten irgendetwas ankommt, ist mehr als zweifelhaft. Hinzu kommt, dass vorteilhafte Wirkungen der wenigen, bislang realisierten Präventions-Maßnahmen auf Bundesebene z.B. zum Thema Tabakkonsum merkwürdigerweise nur bei den gehobenen Gesellschaftsschichten ankommen.
Prävention: Wirklich Fundament unserer Gesellschaft?
Schlimmer aber: Der BMG-Entwurf reduziert Prävention lediglich auf eine ökonomische Bestrebung: „Gesundheit ist eine Voraussetzung für Wirtschaftskraft, Innovationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit des Gemeinwesens“ heißt der erste Satz des von Ulla Schmidt vorgelegten Entwurfes. Dies ruft zu Recht Kritik hervor. Nicht nur bei der Bundes-ärztekammer, die in dem „BMG-Entwurf die Gesundheitschancen für sozial Benachteiligte konterkariert“ sieht. Sondern auch bei jenen, die sich an ähnliche Entwicklungen vor rund 70 Jahren erinnert fühlen. Wohl mit gutem Grund, denn auf dem Berliner Kongress traten Wissenschaftler und Gesundheitspolitiker auf, die der Prävention wieder eine wenn nicht gar die zentrale Bedeutung im Gemeinwesen zuschreiben Prävention als Basis aller lenkenden Aktivitäten des Sozialstaates. Aber cave! Ärztinnen und Ärzte sollten wachsam bleiben ob solcher Neuauflage „heiliger Pflichten gegenüber dem Volkskörper zum Wohle aller“ und sich vielleicht besser an ihre, von Samuel Hahnemann schon 1810 so trefflich zusammengefasste Aufgabe erinnern: „Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt“.
Rainer H. Bubenzer