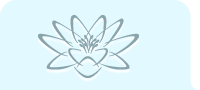Herz-Kreislauf und Psyche bei chronischem Stress
Chronischer Stress ist das Erwachsenenproblem eines ganzen Jahrhunderts. Dies spiegelt sich wieder in der Tatsache, dass jeder vierte Mann und jede dritte Frau zumindest zeitweise unter voll ausgeprägten psychischen Störungen leidet, so die Nachricht von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.
Man kann davon ausgehen, dass chronischer Stress die Entstehung einer viszeralen (bauchbetonten) Adipositas fördert, sagte Carola Wießmann, Ernährungswissenschaftlerin aus Bonn anlässlich des Ernährungskongress in Nürnberg.
Mit der Vermehrung von Fettzellen im Bauchraum entsteht ein hochaktives Sekretionsorgan, das Entzündungszellen und Hormone stimuliert, die letztendlich das Risiko einer Depression deutlich ansteigen lassen im Kollektiv der Übergewichtigen und Adipösen.
Vor dem Hintergrund, dass ein Zusammenhang besteht zwischen viszeraler Adipositas und einer neuroendokrinen Regulationsstörung, sind der Hypothalamus, die Hypophyse und die Nebennierenachse in die Sekretionleistung der Fettzellen und den chronischen Stress einbezogen. Die Insulinsekretion und der Leptinmetabolismus erfahren da durch eine Dysregulation: über die Stressachse des Gehirns werden Adrenalin und Noradrenalin vermehrt gebildet, die zum Anstieg des Kortisols führen. Damit entwickelt sich eine Hyperkortisolämie (zu viel Kortison im Blut), die als Ausdruck einer chronischen Stressbelastung gilt. Durch die Vermehrung des Stresshormons Kortisol werden die Glukokortikoid-Rezeptoren aktiviert, und eine negative Beeinflussung des Fettstoffwechsel (Lipidmetabolismus) ist die Folge. Es resultiert eine hohe Lipidansammlung in den Fettzellen und die vermehrte Speicherung im Fettgewebe.
Bei dieser Konstellation wird auch die Freisetzung von Sexualhormonen wie Testosteron und Östrogen, ebenso wie eine Behinderung der Wachstumshormone festgestellt.
Experten sprechen dann von einer sympathovagalen Dysbalance, die zum Anstieg des kardiovaskulären Risikos führt und auch der zirkadiane Rhythmus (endogener Zeitgeber)aus dem Takt gerät.
Neue Forschungen sehen im weltweit konstanten Anstieg der Zahl Übergewichtiger und Adipöser eine Anpassungsreaktion an die modernen Lebensbedingungen. Demnach wird dieses Phänomen als allokatives Verhalten gewertet, das vom Gehirn gesteuert wird und sich in der Gewichtsvariabilität der Menschen niederschlägt. Die These vom „selfisch brain“ (egoistischen Gehirn) unterstellt, dass sich unter Stressbedingungen das Essverhalten als Anpassungsmerkmal an die modernen Lebensbedingungen verändert, und in letzter Konsequenz zum Übergewicht führt.
Adipositas und chronischer Stress induzieren ein hohes kardiovaskuläres Risiko und eine Störung der neuroendokrinen Regulation, und beide Veränderungen tragen dazu bei, dass Depressionen in diesem Kollektiv deutlich häufiger registriert werden als in der Normalbevölkerung.
Ob diese Entwicklung eintritt, hängt nach Wießmann stark vom Gentypus ab, und auch die phänotypische Plastizität hat wesentlichen Anteil daran, ob ein Mensch mit extremer Gewichtszunahme reagiert oder ob er unabhängig von der Menge der täglichen verzehrten Nahrung ein Leben lang schlank bleibt. Die chronische Stressbelastung als wichtiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen zeigt einen hohen Forschungsbedarf, um dieses Rätsel aus Stress – Übergewicht – Herz-Kreislaufschädigung und Depressionsentstehung aufzuklären.