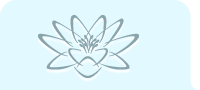Gut zu wissen
Kalorienreduktion und Sport nutzt nicht jedem übergewichtigen Diabetiker
Mehr als sechs Millionen Diabetiker sind in Deutschland diagnostiziert und behandelt. Mit mehr als 90 Prozent handelt es sich um Typ 2-Diabetiker. Jährlich werden 270.000 Neuerkrankungen registriert und eine hohe Dunkelziffer nicht-erkannter Diabetikern wird vermutet.
Als erste Maßnahme wird den Betroffenen eine Lebensstil-Umstellung empfohlen, weil der Typ 2-Diabetes oft mit Übergewicht und Adipositas sowie mit einer Verweigerung jeglicher körperlicher Aktivität verbunden ist. Mit gesunder, ausgewogener Ernährung und vermehrter Bewegung lässt sich die Stoffwechselsituation des Diabetikers deutlich verbessern, Antidiabetika und Insulin können die pathologischen Blutzuckerwerte normalisieren.
Neuere Studien, wie das Tübinger Lebensstil-Interventionsprogramm (TULIP) haben allerdings gezeigt, dass nicht jeder Diabetiker von einer Umstellung seiner Lebensweise profitiert. Damit sollte die Frage beantwortet werden, warum manche trotz Gewichtsreduktion oder sogar mit Normalgewicht dennoch einen Typ 2-Diabetes entwickeln. Dabei scheinen nicht nur die genetischen Faktoren, sondern auch der Anteil des Bauchfetts und die Leberverfettung eine Rolle zu spielen.
Bisher wurde davon ausgegangen, dass weniger Kalorien und mehr Sport die erfolgversprechendste Methode zur Gewichtsreduktion und Diabetesprävention ist. „Die Studien belegen, dass diese Maßnahme nicht bei jedem Menschen gleich effekjtiv ist“, sagte Professor Norbert Stefan, Präsident des Diabeteskongress 2015 von der klinisch experimentellen Diabetologie der Universität Tübingen „Den Untersuchungen zufolge müssen sieben Personen mit einem Prädiabtes über einen Zeitraum von drei Jahren behandelt werden, damit eine Diabeteserkrankung verhindert wird“.
Im Tübinger Lebensstil-Interventionsprogramm untersuchten Professor Stefan und Kollegen warum manche Patienten weniger stark oder sogar überhaupt nicht auf die Veränderung der Lebensgewohnheiten ansprechen und deren Diabetesrisiko nicht unbedingt sinkt. Die Experten vermuten, dass genetische Variationen, die Einfluss auf die Insulinwirkung und Insulinproduktion haben dafür ursächlich vernatwortlich sind. Dabei steht ein Rezeptor des Fettgewebshormons Adiponektion im Fokus. Dieses Protein und das bei Fettleber vermehrt freigesetzte Hepatokin Fetuin A spielen dabei ebenfalls eine Rolle, weil es die Insulinwirkung reduziert und die Produktion von Entzündungsstoffen erhöht. Anhand dieser Biomarker wird zukünftig eventuell das persönliche Diabetesrisiko besser vorhersagbar sein und es kann festgestellt werden, welche Patienten von einer Umstellung des Lebensstils profitieren, prognostiziert Stefan. Er vermutet, dass eventuell auch der Zusammenhang zwischen Fettleber, Typ 2-Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen aufgedeckt werden könnte.