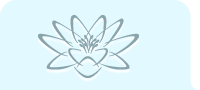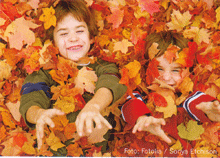Gut zu wissen
Geschwister von chronischkranken und behinderten Kindern – ein Thema für die Praxis
Kinder mit besonderer Belastung brauchen besondere Orte, die ihnen Schutz und Geborgenheit geben und ein gesundes Aufwachsen fördern. In Deutschland leben mindestens 2,6 Millionen Kinder mit einem chronisch kranken oder behinderten Geschwisterkind, das die vermehrte elterliche Fürsorge beansprucht. Während sich das gesunde Geschwisterkind dadurch oft zurückgesetzt fühlt, werden gleichzeitig noch besondere Anforderungen und großes Verständnis von ihm erwartet.
Viele dieser Kinder haben ein erhöhtes Risiko für psychische und soziale Probleme und Belastungen, und sie bedürfen der besonderen Hilfe im Umgang mit dem erkrankten Geschwisterkind, im familiären Zusammenleben und in der Freizeit. Dabei können in vielen Fällen schon Gespräche mit Gleichbetroffenen, mit Eltern, Ärzten oder anderen professionellen Helfern sehr hilfreich sein, sagte Privatdozent Michael Kusch vom Institut für Gesundheitsförderung und Versorgungsforschung gGmbH (IGV) der Ruhr-Universität in Bochum, anlässlich der Pressekonferenz von FamilienBande, einer von Novartis ins Leben gerufenen Initiative. Diese Initiative engagiert sich gemeinsam mit Wissenschaftlern und Partnern aus dem Gesundheits-, Sozial- und Familienbereich für diese Kinder und deren Familien.
Bisher gibt es kein strukturiertes Vorgehen bei der Erfassung der Probleme und Belastungen der Geschwister von Kindern mit besonderem Versorgungsbedarf, so der Referent, der als Ursache nicht nur die unzureichende wissenschaftliche Fundierung, sondern auch das geringe Augenmerk im Gesundheitswesen sowie die fehlende Finanzierung und wissenschaftliche Qualität der Leistungserbringung erkannte.
Aufgrund dieser Situation wurde speziell für FamilienBande ein Früherkennungsinstrument mit LARES-Geschwisterkinder ins Leben gerufen, das mit dem Erkennen des Problems zeitgleich auch die Art der Unterstützung ermittelt, die dem Kind hilft. Dazu wurden zwei Fragebogen entwickelt, der den Eltern und den Kindern Gelegenheit gibt, die spezifischen Probleme der beteiligten Familienmitglieder zu formulieren und in gemeinsamer Interaktion die Sichtweise der Eltern und der Kinder zu erkennen.
Im Rahmen einer großen Validierungsstudie wird geprüft, ob die Fragebogen auch das messen und wiedergeben, was sie messen sollen. Dabei sind zwei Kriterien entscheidend, nämlich die Qualität des Verfahrens sowie die Ökonomie der Vorgehensweise.
Daraus soll ein ökonomisches und valides Instrument zur Erfassung des Hilfsbedarfs von Geschwistern mit besonderem Versorgungsbedarf erarbeitet werden, das nicht nur der Identifizierung dieser Kinder, sondern auch als Bindeglied zwischen der Bedürfnislage und den möglichen Angeboten zur Unterstützung durch die Leistungserbringer dient.
In einer Befragung des beta-Instituts wird gezeigt, dass in der täglichen Praxis die Thematik durchaus präsent ist. So fällt 93 Prozent der Pädiater spontan etwas zu den Geschwistern chronisch erkrankter oder behinderter Kinder ein, 88 Prozent können sich vorstellen, die erkennbaren Probleme in die Praxisroutine aufzunehmen, und 85 Prozent halten ein präventives Instrument zur Früherkennung für hilfreich, so Waltraut Baur und Antje Otto vom gemeinnützigen beta-Institut in Augsburg. Von 75 Prozent der Pädiater wird die Ansicht vertreten, dass ein Informationsdienst, der auf Hilfsangebote für Geschwisterkinder verweist, hilfreich in der täglichen Praxis etabliert werden könne.
Die spezifischen Fehlentwicklungen bei Geschwisterkindern wurden von Dr. Dirk Mundt, Chefarzt des Sozialpädiatrischen Zentrums in Düren aufgelistet.
- häufig ist das Alltags-Lernprogramm erschwert
- Wünsche müssen oft zurückstehen, weil das Sorgenkind in der Familie die Aufmerksamkeit der Eltern fordert
- die Kinder werden mit hoher Sozialkompetenz ausgestattet und übernehmen Mit-Verantwortung
- bei nicht ausreichender Achtsamkeit der Eltern kann es zu psychischen Fehlentwicklungen kommen
- es können externalisierende und internalisierende Verhaltenstörungen auftreten, sowie Schulversagen oder sozialer Rückzug.
Die Infoline FamilienBande unterstützt bei Fragen zu Geschwisterkindern:
Tel.: 01805-322633
Weitere Informationen unter: www.initiative-familienbande.de