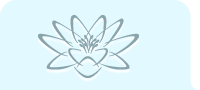Gut zu wissen
Fischkonsum zum Wohl des Neugeborenen
Seefisch ist die wichtigste Quelle für Omega-3- Fettsäuren, die wiederum als essenziell für eine optimale Entwicklung des Nervensystems gelten. Dennoch empfehlen die öffentlichen Stellen in den USA seit 2004 Schwangeren den Konsum von Seefisch auf maximal 340 Gramm pro Woche zu begrenzen, um den Fötus nicht metallorganischen Quecksilberverbindungen auszusetzen. Auf diese Weise liegt der Anteil der durch die Nahrung zugeführten Quecksilberverbindungen in der amerikanischen Bevölkerung bei 0,02mg/kg Körpergewicht.
Eine englische Forschergruppe (the Avon Longitudinal Study of Parents and Children, ALSPAC, Hibbeln JR et al Lancet 2007; 369: 578-85) hat nun in einer Längsschnittuntersuchung bei fast 12.000 Schwangeren die Auswirkungen des Seefischkonsums auf die Entwicklung ihrer ungeborenen Kinder untersucht. Dabei werteten sie die Angaben zu Fischkonsum der Schwangeren aus und untersuchten deren Kinder bis zum Alter von acht Jahren. Bewertet wurden soziales Verhalten, soziale Fähigkeiten, Feinmotorik und Kommunikation der Kinder.
Während ein Fischkonsum von weniger als 340 Gramm pro Woche der Mutter sich ungünstig auf die Entwicklung des Kindes auswirkte, förderte ein höherer Konsum die Entwicklung der Kinder. Je mehr Fisch die Schwangeren verspeisten, desto besser verlief die Entwicklung des Kindes.
Die Wissenschaftler führen diesen Effekt auf die Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch zurück. Daher sind sie der Meinung, dass die Grenze von 340 Gramm Seefisch pro Woche unbedingt überschritten werden müsse. Sie schätzen das Risiko möglicher Schädigungen durch die damit verbundene Zufuhr metallorganischer Quecksilberverbindungen für geringer ein, als die ungünstige Entwicklung des Kindes durch mangelhafte Zufuhr der Omega-3-Fettsäuren.
Immerhin war der Anteil der durch die Nahrung zugeführten Quecksilberverbindungen in der untersuchten ALSPAC Bevölkerung mit 0,05 mg/kg Körpergewicht mehr als doppelt so hoch als der der amerikanischen Bevölkerung.