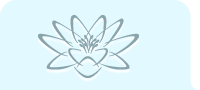Gut zu wissen
Die grausame Schönheit des weißen Goldes: Exquisite Elfenbeinschnitzereien im Frankfurter Liebieghaus
Ein ideales Weib, glatt, weiß, tänzelnd. Die Arme, wie flatternde Zweige im Wind. Aus den Fingern sprießt Blattwerk, in den Locken wächst Laub. Ihr Häscher, halb Gott, halb Jäger, hält sie vergeblich gefangen. Der Elfenbeinschnitzer Jacob Auer zeigt die Zuspitzung höchster Not: Die bedrängte Daphne entzieht sich, verwandelt sich für immer in einen Baum. Apoll bleibt ratlos zurück. Wie die glatte Haut gegen flatterndes Tuch steht, wie die zarten Zweige gedrechselt sind, wie lebendig die Strähnen auf den Rücken rieseln, all das zeugt von großer Meisterschaft. Ein Können, das erst im weichen, elastischen Elfenbein richtig zur Geltung kommt. Angefangen mit steinzeitlichen Venusidolen aus Mammutstoßzähnen über Antike und Mittelalter bis hin zum Wiener Barock des 17. Jahrhunderts, dem Höhepunkt der europäischen Elfenbeinschnitzerei, steht das weiße Gold für die kostbarsten Stücke der Kleinplastik.
Der satte Schimmer der polierten Oberfläche, die zarte Transparenz und Äderung des organischen Materials machen es dem menschlichen Körper sehr ähnlich, geradezu ideal für die Darstellung nackter Haut, wie sie die Künstler des Barock liebten. Ihr virtuoses Spiel mit natürlicher Illusion und artifiziellem Ornament zeigt jetzt eine Ausstellung im Frankfurter Liebieghaus, wo 36 meisterliche Arbeiten aus der Wiener Kunstkammer und acht weitere aus der Sammlung Reiner Winkler zu sehen sind.
Die weltberühmte Wiener Kunstkammer, noch bis Ende 2012 wegen Sanierung geschlossen, steht für die Sammlungen von Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein und Kaiser Leopold I. Höfische Wunderkammern, die Vorläufer der modernen Museen, entstanden ab Mitte des 16. Jahrhunderts. Hier staunte die Aristokratie über kuriose und künstlerische Objekte. Besonders hoch angesehen war die Elfenbeinschnitzerei. Sogar die Herrscher selbst übten sich in der Drechselei, so wie Kaiser Leopold I., der gleich mehrere Werkbänke besaß. In der Frankfurter Ausstellung ist er mit einem selbstgefertigten Deckelhumpen vertreten.
Exotisch und voller Sinnlichkeit – so empfand man im siebzehnten Jahrhundert das seltene Material aus fernen, unbekannten Ländern. Künstlerische Delikatesse und Vielfalt führen die Augen des Betrachters auch heute noch auf erstaunliche Spaziergänge. Da zeigen rundliche Putti weiche Speckfalten, da flattert die filigrane Spitze eines Überwurfs sanft im Wind, da winden sich Hunde, Jäger und Meeresgetier zum unnachahmlichen Henkel einer Deckelkanne. Doch als ob sie die selbst geschaffene Schönheit grausam brechen wollten, zeigen die Meister oft Themen voller Drastik und Gewalt. Im 1657 entstandenen Urteil des Salomon beispielsweise greift ein grobschlächtiger Scherge, das Schwert in der Rechten, nach dem strampelnden Kind. Nur die verzweifelte Mutter verhindert, dass er es in zwei Teile teilt. Die berühmtesten Meister des 17. Jahrhunderts Adam Lenckhardt, Johann Caspar Schenck, Matthias Steinl oder der Meister des Sebastiansmartyriums wussten ihre Inhalte dramatisch zuzuspitzen. Ob nun das Martyrium des Heiligen Sebastian oder, grausamste aller antiken Mythen, die Schindung des Marsyas, was den Betrachter vor Brutalität schaudern lässt, bringt die ästhetische Delikatesse umso mehr zum Leuchten.
Vordergründig haben sie einen praktischen Nutzen, doch weder Kanne, Pulverbeutel, Pokal oder Humpen, nichts hat je einen profanen Dienst getan. Alles diente einzig der Schönheit und der geistigen Erbauung. Andere Stücke zeigen ein virtuoses Spiel mit der Form des Stoßzahns, die ja das äußere Maß der Elfenbeinplastik beschränkt. Matthias Steinls um 1688 entstandene „Allegorie der Elemente Wasser und Luft“ ist aus einem Walrosszahn gefertigt, dessen Konturen noch deutlich zu erkennen sind. In kunstvoller Form winden sich Meeresgötter und Nymphen umeinander bis die Szene in einer zusammengerollten Fahne als Allegorie der Luft mündet – Gipfel kleinplastischer Schönheit, wie sie noch bis zum 26. Juni im Frankfurter Liebieghaus zu bewundern ist.
Gabriele Derouiche
Liebieghaus Skulpturensammlung
Schaumainkai 71
60596 Frankfurt
Tel. 069 650049-0
www.liebieghaus.de
geöffnet Dienstag, Freitag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Donnerstag 10 bis 21 Uhr