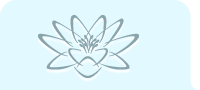Gut zu wissen
Diabetische Neuropathie ist ein Feld chronischer Vernachlässigung
Jeder dritte Diabetiker ist von einer relevanten distal symmetrischen sensomotorischen Neuropathie betroffen. Bei den meisten ist die Erkrankung nicht bekannt, weil noch immer ein Viertel der Betroffenen diesbezüglich nicht von ihrem behandelnden Arzt untersucht, diagnostiziert, geschweige denn behandelt werden.
Neben quälenden neuropathischen Schmerzen haben diese Menschen ein hohes Risiko für die Entstehung eines diabetischen Fußsyndroms mit schmerzlosen Ulzerationen, die wiederum nicht selten eine Amputation nach sich ziehen, sagte Professor Dan Ziegler vom Deutschen Diabetes Zentrum der Universität Düsseldorf. Mit Hinweis auf neue Erkenntnisse aus klinischen Studien zu multifaktoriellen Pathogenese der Neuropathie plädierte er für therapeutische Ansätze, die streng auf die pathogenetischen Mechanismen zielen. Zur Diagnose ist ein Score zur Objektivierung der neuropathischen Symptomen und Defizite wichtig, der auch zur standardisierte Verlaufskontrolle geeignet ist.
Früherkennung und Prävention stehen bei Risikopatienten, wie Diabetiker, Adipösen, Hypertonikern und Personen mit Alkohobusus im Vordergrund. Dies ist vor allem bei der „stillen“ Neuropathie eine große Herausforderung, sagte Professor Kristian Rett, Endokrinologe und Diabetologe am Krankenhaus Frankfurt-Sachsenhausen, der die diabetische Neuropathie als Chamäleon der Diabetologie bezeichnete. Oft werden unspezifische Symptome, unterschiedliche Schmerzcharakteristik und Missempfindungen geklagt, sowie das ganze Spektrum gastrointestinaler Beschwerden. Zur korrekten Bestimmung sind die Scores ausgesprochen hilfreich; dennoch sollte jeder Patient frühzeitig und direkt auf neuropathische Symptome angesprochen werden, so Rett. „Wenn die Neuropathie symptomatisch geworden ist, liegt bereits eine fortgeschrittene Neuropathie vor, bei der die Möglichkeiten der Therapie bereits limitiert sind“. Er plädierte für die unbedingte jährliche Fußuntersuchung jedes Diabetikers, bei der die Hautbeschaffenheit, Fußdeformität und Nagelbettveränderungen akribisch inspiziert werden. Vibrationsempfinden, Temperatur-Diskriminierung und Berührungssensibilität sind Basisuntersuchungen, die niemals vergessen werden dürfen. Ebenso gehören die Fußpulse sowie die motorische Komponente zu den Basics der Neuropathiediagnostik. Vor allem sollten auch die diagnostischen Stolpersteine bekannt sein, z.B. wenn ein Karpal- oder Tarsaltunnelsyndrom die Schmerzsituation triggert.
Die Realität zeigt das Bild einerer chronischen Vernachlässigung, sagte Professor Oliver Schnell vom Helmholtz-Zentrum München, der sich auf die aktuellen Daten der bundesweiten Aufklärungsinitiative „Diabetes! Hören Sie auf Ihre Füße“ bezog. Die vom Unternehmen Wörwag Pharma initiierte Initiative konnte bereits bei mehr als 1000 Menschen mit bekanntem Diabetes einen Fußcheck durchführen, deren Befunde wissenschaftlich ausgewertet wurden. Bei mehr als 50 Prozent der Teilnehmer mit Typ-2-Diabetes wurden Hinweise auf eine beginnende oder bereits klinisch manifeste Neuropathie gefunden, und „diese Ergebnisse sind alarmierend“, so der Referent. Er begründet dies mit der Vernachlässigung der Fußuntersuchungen, die häufig zu kurz kommen in der täglichen Praxis. Hohe Aufmerksamkeit für die Problematik der Diabetiker erzielt die Initiative des Unternehmens Wörwag, die bereits mehr als 12.000 Standbesucher registrieren konnte. Ein Podologe führt einen professionellen Fußcheck durch und erfasst Temperatur, Druck und Sensibilität, und mit der Erhebung von Lebensalter, HbA1c und Geschlecht wird eine graduierte Klassifikation der neuropathischen Störungen vorgenommen.
Die Unterscheidung in Nicht-Diabetiker (n=359), Typ 1-Diabetiker (n=80) und Typ 2-Diabetiker (N=544) ergab bereits bei 25 Prozent der Nicht-Diabetikern Hinweise auf ein neuropathisches Geschehen und mehr als 50 Prozent der Typ 2-Diabetikern zeigten eine beginnende oder bereits klinisch manifeste Neuropathie.
„Je später eine Neuropathie bekannt wird, umso schwerer sind die Folgen die Nervenschädigung“, sagte Professor Ralf Lobmann vom Klinikum Stuttgart-Bürgerhospital und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft „Diabetischer Fuß“. Jede manifeste periphere Neuropathie ist zu 30 bis 50 Prozent mit einer autonomen Neuropathie assoziiert. Durch die Empfindungsstörung und der extrem trockenen Haut der Füße kommt es häufig zu unbemerkten Verletzungen, die weder einer Inspektion noch einer Behandlung zugeführt werden. Gleichzeitiges Auftreten von sensibler und motorischer Komponente der Neuropathie induziert Fehlbelastung, Gangunsicherheit und plantare Drucküberlastung, die mit einem hohen Ulkusrisiko verbunden sind. Die Folgen des diabetischen Fußes sind oft fatal, so Lobmann, weil „alle 15 Minuten in Deutschland eine Diabetes-assoziierte Amputation vorgenommen wird, deren postoperative 1-Jahres-Letalität bei 20 Prozent liegt“. Er forderte eine sektoren- und fachübergreifende Kooperation, die zur relevanten Verbesserung der Diagnostik und Therapieerfolge beitragen würde.
Auf die pathogenetisch orientierte Therapie bezog sich Professor Karl-Heinz Reiners von der Neurologischen Klinik in Würzburg in seinem Vortrag, in dem er die drei Säulen der Neuropathie-Therapie beschrieb. Als übergeordnetes Behandlungsziel kennzeichnet er das Erreichen einer Normoglykämie, neben der die konsequente Therapie von Risikofaktoren, wie der viszeralen Adipositas, Hypertonie und Hyperlipidämie stehe. Nikotin- und Alkohol-Abusus sollten unbedingt vermieden werden.
Die zweite Säule bestehe in der Blockierung der pathogenen Stoffwechselwege, die zelltoxische Auswirkungen haben. „Zentrales Ziel bei diabetischer Neuropathie ist die Gabe von Benfotiamin“, sagte Professor Reiners. Dabei wird ein Vitamin B1-abhängiges Schlüsselenzym des Glukosestoffwechsels aktiviert, und an mindestens vier Stellschrauben der Pathogenese einer diabetischen Neuropathie regulierend eingegriffen. In großen klinischen Studien ist belegt , dass die neuropathischen Beschwerden wie Schmerzen, Taubheit und Brennen der Füße gelindert werden, und die Nervenfunktion positiv beeinflusst wird. Der größte Erfolg ist u erwarten bei einer besonders frühen Intervention mit Benfotiamin, weil die primär toxische metabolische Wirkung auf die Funktion des Gefäßendothels verringert und daraus resultierende mikrovaskuläre Komplikationen gebessert werden.
Als dritte Säule steht die rein symptomatische Behandlung chronisch-neuropathischer Schmerzen, die aber für jeden einzelnen Patienten eine sorgfältig titrierte Dosierung vorraussetzt, bei der immer das individuelle Ansprechen zählt, die von der individuellen Wirkung, Nebenwirkung und Komorbiditäten abhängig ist.